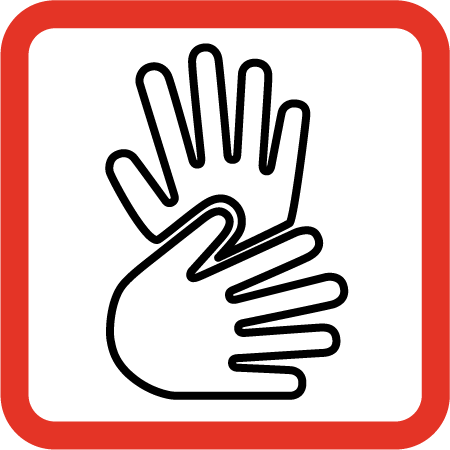Familiengerichtshilfe
 Die
Familiengerichtshilfe unterstützt Familienrichter:innen bei ihrer
Entscheidungsfindung in Angelegenheiten der Obsorge und des Rechts auf
persönliche Kontakte. Eingerichtet wurde sie mit dem Kindschafts- und
Namensrechtsänderungsgesetz 2013.
Die
Familiengerichtshilfe unterstützt Familienrichter:innen bei ihrer
Entscheidungsfindung in Angelegenheiten der Obsorge und des Rechts auf
persönliche Kontakte. Eingerichtet wurde sie mit dem Kindschafts- und
Namensrechtsänderungsgesetz 2013.
Die Familiengerichtshilfe berichtet dem Gericht über ihre fachliche Einschätzung und liefert somit wichtige fachliche Entscheidungsgrundlagen für das Gericht, um eine dem Kindeswohl entsprechende Lösung zu finden.
Die Familiengerichtshilfe hat die folgenden wesentlichen Aufgaben:
Clearing (Anbahnung einer gütlichen Einigung zwischen den Eltern):Wird die Familiengerichtshilfe mit dem „Clearing“ beauftragt, führt sie mit der betroffenen Familie persönliche Gespräche, um herauszufinden welche wesentlichen Streitpunkte es gibt, wo die Konfliktquellen liegen und ob bzw. wie die Eltern zu einer Einigung kommen können.
Sammlung von
Entscheidungsgrundlagen: Das
Gericht kann die Familiengerichtshilfe auch damit beauftragen, spezielle
Erhebungen durchzuführen. Die Familiengerichtshilfe prüft dabei einzelne, klar
definierte Sachverhalte, die vom Gericht vorgegeben werden, wie beispielsweise
ob ein Haushalt kindgerecht ist.
Fachliche Stellungnahmen:
Können sich die Streitparteien nicht einigen, muss das Gericht eine Entscheidung treffen. Expertinnen und Experten der Familiengerichtshilfe stellen in einer Stellungnahme die aus ihrer Sicht besten Lösungen für das Kind dar und versuchen ein gutes Gesamtbild von den Bedürfnissen und Wünschen des Kindes zu erstellen. Dabei kommen beispielsweise Hausbesuche oder (Test-)Verfahren zum Einsatz. Die Situation der Familie wird ausführlich beschrieben, um dem Gericht einen fachlich fundierten Vorschlag liefern zu können.
Klärung des Kontaktrechts („Besuchsmittlung“):
Mit der „Besuchsmittlung“ werden Familienangehörige bei Konflikten dabei unterstützt, wie die persönlichen Kontakte zu dem Kind gestaltet werden können. Die Familiengerichtshilfe kann beispielsweise den Eltern dabei helfen, ein Übergaberitual im Sinne des Kindeswohls zu gestalten und bei einzelnen Über- und Rückgaben des Kindes anwesend sein.
Für die ersten fünf Monate ist die Tätigkeit der Familiengerichtshilfe als „Besuchsmittlerin“ kostenlos. Sollte die Familiengerichtshilfe weiterhin in der Besuchsmittlung beauftragt werden, fallen Kosten an. Die Parteien können Verfahrenshilfe zur einstweiligen Befreiung dieser Gebühren beantragen.
Nähere Informationen zur Familiengerichtshilfe in der Funktion der Besuchsmittlerin:
Die Funktion der Familiengerichtshilfe als Besuchsmittlerin wurde mit dem Kindschafts- und Namensrechtsänderungsgesetz 2013 eingeführt. Die Besuchsmittlerin soll das Gericht bei der optimalen Gestaltung der Besuchskontakte unterstützen.
Aufgaben der Besuchsmittler:innen:
- Aufklärung des Kindes darüber, dass es nicht schuld am Konflikt der Eltern und den Schwierigkeiten bei den Besuchskontakten ist.
- Verständigung über die
konkreten Modalitäten der persönlichen Kontakte und Vermittlung bei Konflikten
(nach Rücksprache mit dem Kind)
Beispiel: Klärung, ob das Kind bestimmte Rituale bei der Übergabe benötigt (z.B. ruhiges Abschiednehmen vom betreuenden Elternteil eine halbe Stunde vorher), dass auf Pünktlichkeit zu achten ist, welche persönlichen Gegenstände des Kindes zu übermitteln und welche (Schul-)Aufgaben zu bewältigen sind. - Wenn nötig: Vor-Ort-Hilfe bei der Abwicklung der Kontakte, indem die Besuchsmittler:innen bei der Übergabe anwesend sind. Dabei wird unter anderem Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit geleistet, etwa über die Problematik von Loyalitätskonflikten für Kinder. Sie können auch aktiv vermittelnd eingreifen, wenn Streitpunkte auftauchen. Oft hilft allein die Anwesenheit einer Person, die bereits mit den Eltern beratend gearbeitet hat dabei, dass Konflikte weniger „aufkochen“.
- Spezifische Berichtsfunktion für das Gericht: Die Besuchsmittler:innen haben dem Gericht über Wahrnehmungen zu berichten, um so dem Gericht Entscheidungsgrundlagen zu liefern, falls Zwangsstrafen verhängt werden müssen oder neue Besuchsrechtsregelungen zu treffen sind.
-
pdf